Simone de Beauvoirs Die Mandarins von Paris
Heute erscheint der große Roman Die Mandarins von Paris von Simone de Beauvoir in der Neuübersetzung von Amelie Thoma und Claudia Marquardt im Rowohlt Verlag. Ich habe ihn in den letzten Jahren gleich zwei Mal gelesen und das sehr gern, weil er in der Breite wie im Detail, vom Politischen bis zum Persönlichen und Zwischenmenschlichen eine Welt des Umbruchs erzählt und uns damit siebzig Jahre nach seinem ersten Erscheinen wieder viel zu sagen hat. Für die neue Übersetzung, die den Text so modern wirken lässt wie zur Zeit seines ursprünglichen Erscheinens, durfte ich ein ausführliches Nachwort beisteuern. Hier – als kleiner Appetitmacher – eine gekürzte Fassung.
Bald nach Erscheinen im Jahr 1954 wurde Die Mandarins von Paris zusammen mit einigen anderen Titeln für den Prix Goncourt nominiert, schon damals der Literaturpreis für den französischsprachigen Roman des Jahres. Für Simone de Beauvoir war eins sofort klar: An den Veranstaltungen und Terminen, die die Preiszeremonie in der Zeit zwischen Bekanntgabe der Nominierten und Entscheidung vorsah, würde sie nicht teilnehmen. Sie war den Pariser Literaturbetrieb und die Presse mehr als leid, denn sie überzogen sie, seit fünf Jahre zuvor ihr Buch Das andere Geschlecht erschienen war, mit Hohn und Häme. Der tausendseitige Essay war eine klar und sachlich argumentierende Untersuchung der historischen Prozesse, aus denen die Frau als Abhängige, als Zweitrangige hervorgegangen war, eine scharfsinnige Analyse von Mythen und Aberglauben, von Religion, Ideologie und Literatur. Damit erschütterte de Beauvoir die geistigen Grundlagen, auf denen die Vorherrschaft des Mannes basierte. Hinzu kam, dass sie und Sartre in Paris Berühmtheiten waren, seit in aller Munde war, was inzwischen auch die beiden widerwillig als „Existenzialismus“ bezeichneten. In den Pariser Cafés wurden sie angestarrt, auf der Straße von Fotografen verfolgt, sogar in den USA füllten Sartre und de Beauvoir seitenweise Zeitschriften wie Vogue, Harper’s Bazaar und Atlantic Monthly.
Das, was man wohl einen Hype nennen kann, hatte neun Jahre zuvor seinen Anfang genommen, unmittelbar nach Kriegsende. Im Sommer und Herbst 1945 hatten de Beauvoir und Sartre zusammen mehr als ein halbes Dutzend Veröffentlichungen herausgebracht, darunter Romane, Vorträge, ein Theaterstück und die neue Zeitschrift Les Temps Modernes. Darin erschien im Dezember 1945 ein Essay von de Beauvoir mit dem Titel „Der Existentialismus und die Volksweisheit“, mit dem sie auf den Vorwurf reagierte, der Existenzialismus sei eine pessimistische Lehre mit einer ungesunden Betonung auf menschlicher Sittenlosigkeit und Tod. In ihrem Essay schrieb sie ironisch, die menschliche Misere und die Tatsache der Sterblichkeit seien wohl kaum etwas Neues, genauso wenig wie die Frage, warum wir geboren würden, was wir hier machten oder welchen Sinn das Leiden habe. Ihr reichte es langsam, ständig gefragt zu werden, was es ihr bringe, Existenzialistin zu sein. Das sei schon eine sehr merkwürdige Frage an eine Philosophin, schließlich hätten sich „weder Kant noch Hegel […] jemals gefragt, was man davon hat, Kantianer oder Hegelianer zu sein; sie sagten, was sie für die Wahrheit hielten, nichts weiter; sie hatten kein anderes Ziel als die Wahrheit selbst“, so de Beauvoir.
Für sie war die Wahrheit, dass sich die Menschen vor ihrer Verantwortung in Ausreden flüchteten. Der Gedanke, dass tugendhaftes Verhalten möglich, aber schwierig sei, widerstrebe den Menschen. Dem Existenzialismus zufolge haben sie die Wahl und tragen damit die Bürde der Freiheit. Jede Art von Determinismus – ob christlich, säkular, moralphilosophisch oder marxistisch – nehme ihnen diese Bürde und, noch entscheidender, die Verpflichtung, diese Freiheit ethisch einzusetzen. Obwohl de Beauvoirs Essays zur Erläuterung des Existenzialismus ihrer Biografin Kate Kirkpatrick zufolge „sorgfältiger durchdacht und strukturiert“ waren als Sartres, wurde ihr intellektueller Beitrag zu dieser Philosophie massiv heruntergespielt. Immer wieder wurde sie als oberflächliche und fantasielose Denkerin abgetan, die nicht zum „wahren“ Philosophen tauge – als den wollte man Sartre sehen. 1945 nannte das sensationslüsterne Nachkriegs-Boulevardblatt Samedi Soir de Beauvoir „la grande Sartreuse“ und „Notre-Dame de Sartre“. Sartre war das Eigentliche; die attraktive und unkonventionelle Frau an seiner Seite galt als seine Muse, sein Anhängsel, das ihn nur faszinierender machte. Zu den persönlichen Beleidigungen, die de Beauvoir nach Erscheinen von Das andere Geschlecht über sich hatte ergehen lassen müssen, gehörten mehrere Aussagen des bekannten katholischen Autors François Mauriac. Ihm zufolge hatte ihr Schreiben „buchstäblich die Grenze des Erbärmlichen erreicht“, sie sei „unbefriedigt, frigid, priapisch, nymphomanisch“, lesbisch, habe hundert Abtreibungen hinter sich und heimlich ein Kind. In einem Brief an Les Temps Modernes schrieb er: „Nun weiß ich alles über die Vagina Ihrer Chefin.“ Nach Erscheinen von Die Mandarins von Paris rechnete de Beauvoir fest damit, dass es in diesem Stil weitergehen würde.
Tatsächlich wurde das Buch jedoch extrem gut besprochen. Am meisten überraschte sie, dass sowohl die politische Rechte als auch die Linke dem Roman etwas Positives abgewinnen konnten. Die erste Auflage von elftausend Exemplaren war schnell vergriffen, Ende des Erscheinungsmonats hatte es sich bereits vierzigtausend Mal verkauft. Und auch den Prix Goncourt bekam sie – als dritte Frau seit der Einführung des Preises im Jahr 1903 einundfünfzig Jahre zuvor. Allerdings wurde das Buch eins zu eins als Schlüsselroman gelesen und wird – trotz de Beauvoirs Einwänden – bis heute als solcher bezeichnet: als wahre Geschichte aus dem Leben der Intellektuellen vom rive gauche. Eine US-amerikanische Ausgabe der Mandarins aus dem Jahr 2005 verspricht „bissig genaue Porträts von Sartre, Camus und anderen intellektuellen Giganten der Zeit“ sowie eine „epische Liebesgeschichte und ein philosophisches Manifest“. Dieser Lesart zufolge versteckte sich hinter der Figur Robert Dubreuilh Jean-Paul Sartre, hinter Henri Perron Albert Camus, hinter seiner langjährigen Geliebten Paule die Autorin Violette Leduc und hinter Anne Dubreuilh Simone de Beauvoir selbst. Die Literaturkritik und das Publikum lasen den Roman eindimensional so, wie er sie interessierte – und warfen seiner Autorin dann vor, sie sei egozentrisch und schöpfe nur aus ihrem Leben. Der Vorwurf, es mangele ihnen an Fantasie, ihre Texte seien rein autobiografisch, wurde schreibenden Frauen quer durch die Literaturgeschichte immer wieder gemacht, mit dem oft unverkennbaren Ziel, ihnen literarisches Können abzusprechen.
De Beauvoir räumte durchaus ein, dass ihr Roman vom eigenen Leben inspiriert worden war, das heiße jedoch nicht, dass es sich um eine Autobiografie handele. Natürlich nicht, möchte man heute entgegnen, sensibilisiert nicht nur durch die Diskussion um das Genre der Autofiktion der letzten Jahre, sondern auch durch jahrzehntelange literaturtheoretische Debatten zum Thema autobiografisches Schreiben. Aber de Beauvoir sah sich genötigt, sich zu rechtfertigen, und tat das rückblickend und zusammenfassend noch einmal in ihrem Memoirenband Der Lauf der Dinge:
Ich wollte ganz darin aufgehen, ich wollte mein Verhältnis zum Leben, zum Tod, zur Zeit, zur Literatur, zur Liebe, zur Freundschaft, zum Reisen beschreiben. Ich wollte auch andere Menschen schildern und vor allem die fiebrige, von lauter Enttäuschungen begleitete Geschichte der Nachkriegszeit erzählen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem Zusammenbruch der Résistance und „der siegreichen Wiederkehr des bürgerlichen Regimes“ sei der Boden mit zerstörten Illusionen übersät gewesen. Ihr Wunsch war es, ihre jüngsten Erlebnisse durch Worte zu retten. Allerdings sei ein Erlebnis keine Reihe von Tatsachen, und ihr sei es nicht um eine Chronik gegangen. Eine der wesentlichen Rollen von Literatur sei es für sie, widersprüchliche Wirklichkeiten zu formulieren, was in manchen Fällen dadurch gelinge, dass man diese Wirklichkeiten in die „Einheit eines imaginären Objekts“ einzeichne. Ihrer Meinung nach „konnte nur ein Roman den vielfältigen und wechselnden Sinn der veränderten Welt herausstellen“, in der sie nach der Befreiung von Paris und dem Ende der Résistance im August 1944 aufgewacht war. […]
Die bürgerlichen Werte, als deren Bekämpferin Simone de Beauvoir mit ihrem Roman Sie kam und blieb von 1943 und mit ihrer Studie Das andere Geschlecht Aufsehen erregt hatte, sind in Die Mandarins von Paris bereits außer Kraft gesetzt. An ihre Stelle treten die existenzialistischen Werte, das Streben nach Entscheidungsfreiheit, Wahrhaftigkeit und Freiheit sowie der Anspruch, verantwortungsvoll mit den unvereinbaren Widersprüchen umzugehen, die solche Werte im individuellen Leben mit sich bringen. De Beauvoirs Charaktere stehen immer wieder vor Situationen, in denen sie zwischen Alternativen wählen müssen. Dabei erweisen sich nicht nur die Verräter, die Kollaborateure und Demoralisierten als widersprüchliche Gestalten, sondern auch die zunächst „Guten“. Widersprüchlichkeit erscheint geradezu als Kriterium für charakterliche Wahrhaftigkeit. So stehen nicht nur die Protagonist*innen, sondern auch viele Nebenfiguren im Laufe der Handlung vor einer Wahl, vor Herausforderungen, durch die sie sich und ihre Prinzipien in Frage stellen, um sich dann neu zu finden.
Sein bedeutete für de Beauvoir zuallererst Handeln, und zwar mit dem Ziel der Freiheit. Diese entsteht in der Kommunikation mit den anderen, die ihrerseits frei sein sollen, was wiederum die Voraussetzung für die eigene Freiheit ist. So ist Henri erst frei von Paule, als diese sich endlich aus der Beziehung zu ihm löst, sich von dem Bestimmtsein durch ihn freimacht. Und auch für sie gilt, wie für alle anderen Figuren des Romans: Nur durch Handeln kann sich der Mensch verwirklichen, nur indem er seinen Selbstentwurf permanent erneuert und überarbeitet und dadurch überschreitet. Das gelingt den Figuren unterschiedlich gut, was auch mit ihrem Geschlecht und den daran geknüpften Bedingungen zu tun hat. Dass die existentialistischen Werte auch einen gender-Aspekt haben und in westlichen, kapitalistischen Gesellschaften für Männer leichter umsetzbar sind als für Frauen, hatte de Beauvoir schon in Das andere Geschlecht herausgearbeitet. In Die Mandarins von Paris ringen die Frauen um den Sinn des weiblichen Daseins. Es fällt auf, dass es im Roman keine beispielgebende weibliche Figur gibt, keine, die als Vorbild für das feministische Ideal dienen könnte. Schon von der zeitgenössischen Kritik wurde das mit Enttäuschung registriert. Aber es war eine bewusste Entscheidung de Beauvoirs, die sie damit begründete, erzählen zu wollen, was ist – realistisch, nicht idealistisch, nicht utopisch. […]
Als de Beauvoir 1986 starb, meldete Le Monde ihren Tod mit der Schlagzeile: „Ihr Werk: Mehr Popularisierung als Kreation“. Und die Zeitung war bei weitem nicht das einzige Medium, das noch in den Nachrufen mit Abwertung und Schmähung arbeitete, vielfach inkorrekt und sexistisch. Nirgendwo fehlte Sartres Name, anders als bei seinem Tod acht Jahre zuvor, als de Beauvoir in vielen Nachrufen nicht mal erwähnt wurde. Dass sich hier zwei Menschen ein Leben lang intellektuell herausgefordert und einander bereichert hatten, sollte so nicht sein, es musste eine Hierarchie – nicht zuletzt der Geschlechter – hergestellt werden. „Sie war auch Gefangene einer sie verurteilenden Gesellschaft“, schreibt de Beauvoirs Biografin Kate Kirkpatrick. „Ihr Leben ist der Beweis für die Doppelmoral, der Frauen in ihrem ‚Frausein‘ ausgesetzt sind, und zeigt insbesondere, welche Repressalien Frauen erleben, wenn sie es wagen, ihre Sicht der Wahrheit auszusprechen – wenn sie die Macht beanspruchen, ‘das sehende Auge zu sein‘, welches das Fehlverhalten der Männer erkennt.“
Es ist höchste Zeit, Abstand zu diesen Schmähungen zu nehmen und de Beauvoir nicht nur als Feministin und Philosophin neu zu entdecken, sondern auch als literarische Autorin. Amelie Thoma und Claudia Marquardt machen es möglich mit ihrer Neuübersetzung, die uns de Beauvoirs Roman in einer neuen Sprache zur Verfügung stellt. So wirkt der Roman auch im Deutschen wieder so modern wie zur Zeit seines ursprünglichen Erscheinens in Frankreich, so ist seine Zugänglichkeit nicht länger verstellt, seine Relevanz und Literarizität wieder gut zu erkennen. Die Mandarins von Paris wurde als Schlüsselroman gelesen und als Bildungsroman contre coeur. Er wurde als Thesen- und Ideenroman verstanden, gemeint als Vorwurf, ein Vorwurf, der allerdings auch schon Dostojewski gemacht wurde, wie de Beauvoir feststellte, die sich damit also in exzellenter literarischer Gesellschaft befand. Dass sich all diese Kategorien auf die Mandarins anwenden lassen, ohne dass sich der Roman durch sie allein fassen ließe, spricht für seine Komplexität und seinen inhaltlichen Reichtum. De Beauvoir schilderte darin die Fragen, die die Intellektuellen einer konkreten Zeit an einem konkreten Ort beschäftigten, nämlich im Paris der Nachkriegszeit, und schuf damit eine Erzählung von viel weitreichenderer Bedeutung, wie sich zeigt, wenn man die Mandarins heute liest. So sehr sich die politische Grundsituation in den siebzig Jahren seit Erscheinen der Originalausgabe geändert hat, so relevant sind die Fragen nach dem Verhältnis von Journalismus und Politik, nach Kunst und Politik, Idealismus und Pragmatismus, nach der Verantwortung jeder und jedes Einzelnen auch heute. De Beauvoir erzählt von zeitlosen Konflikten wie dem Streben nach Wahrhaftigkeit und Freiheit in einer Welt, die diesem Streben entgegenarbeitet. Und auch, wo der Roman von Geschlechterrollen handelt, von weiblichem Begehren und Altwerden, von Machtstrukturen und Doppelmoral, hat er an Aktualität nichts eingebüßt. Die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir ist in ihrem literarischen Werk präsent, wie könnte es anders sein, ihr Wissen, ihr Nachdenken, ihr analytischer wie humaner Blick dienen dem Roman als ungeheure Bereicherung. Vor allem jedoch ist Die Mandarins von Paris, und das macht den Roman heute vielleicht so besonders ansprechend, das Porträt einer Zeit, das in der Breite wie im Detail, vom Politischen bis zum Persönlichen und Zwischenmenschlichen, eine Welt des Umbruchs erzählt. Es ist das mitreißende und nachhallende Werk einer großen Erzählerin.
Nicole Seifert
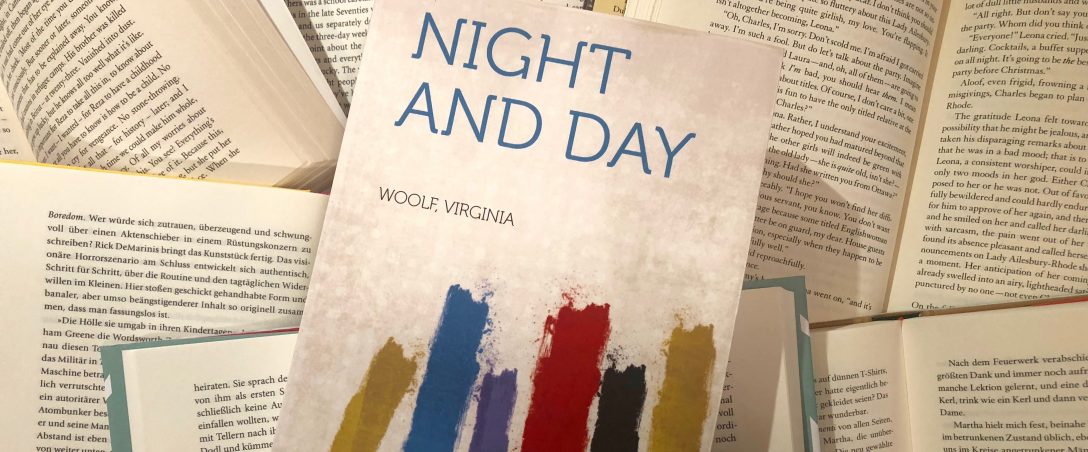

[…] und von Themenbreite her keineswegs mit Beauvoirs opus magnum vergleichen lassen. Trotz der nun vorliegenden Neuübersetzung von Die Mandarins von Paris durch Amelie Thoma und Claudia Marquardt, die im September 2024 bei […]
LikeLike